Über die Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit
BERLIN. Die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) muss für Ärzt*innen nicht unbedingt mit Mehrarbeit verbunden sein. Bereits eine automatische Verknüpfung der auf dem Praxis-PC gespeicherten Patientendaten könnte Muster zeigen und wertvolle Hinweise auf individuelle Risikofaktoren geben. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Patient*innen sich ratsuchend an dialogbasierte Chatbots wendet.
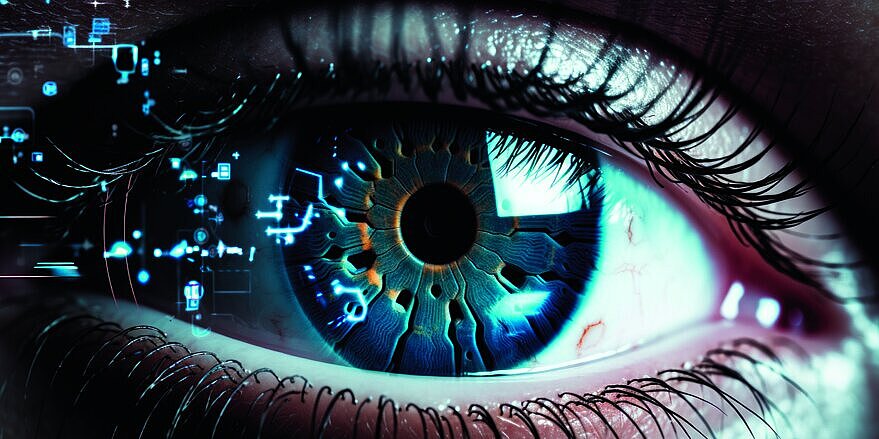
Das Gesundheitswesen ist der Bereich, in dem Stand heute bereits die meisten KI-Anwendungen angesiedelt sind. „Eine Branche mit so vielen Daten ist einfach prädestiniert dafür“, meinte der Psychologe Professor Dr. Bernhard Kulzer vom Diabeteszentrum Mergentheim. KI-Tools könnten zuverlässig Hautkrebs erkennen, das individuelle Herzinfarktrisiko berechnen oder Menschen mit Depressionen leitliniengerecht beraten. Auch für die Prävention bzw. Früherkennung von Diabetes und seiner Folgeerkrankungen könnte man KI-Modelle einsetzen – zumindest theoretisch.
Gut in Studien: Fundusfotografie per Smartphone
„Wenn man ausreichend viele Daten strukturiert erfasst und in Rechenmodelle integriert, sind das ganz simple Rechenoperationen“, erklärte Prof. Kulzer und betonte, es gebe keine einzige Folgeerkrankung des Diabetes, für die noch keine KI-Diagnostik existiert. Auf der internationalen Bühne am weitesten vorangeschritten sei das KI-Screening auf Retinopathie, mit dessen Hilfe man die Inanspruchnahme des Retinopathie-Screenings deutlich verbessern könnte. Aktuell nähmen nur knapp 60 % der Patient*innen den jährlichen Pflichttermin wahr: „Es ist mühselig. Man muss einen Termin beim Augenarzt machen, der nicht sonderlich begeistert ist, massenhaft Nicht-Befunde zu generieren“, sagte der Experte. Einfacher wäre es, in jeder Diabetespraxis ein KI-basiertes Screening-Gerät vorzuhalten und nur echte Verdachtsfälle zur Abklärung in die augenärztliche Praxis zu überweisen.
Wie wichtig eine verbesserte Früherkennung hier wäre, verdeutlichte der Vortrag von Dr. Annie Xia von der Klinik für Augenheilkunde an der Berliner Charité. Sie berichtete, dass gut 28 % aller Menschen mit Diabetes jenseits des 40. Lebensjahrs eine diabetische Retinopathie entwickeln. Bei diesen wiederum komme es in 13 % der Fälle zu einem potenziell visusbedrohenden diabetischen Makulaödem. Zudem sei eine Retinopathie ein eigenständiger Prognosefaktor für kardiovaskuläre und nephrologische Risiken.
Eine schnelle, nicht invasive Möglichkeit der Bildgebung und zugleich gute Basis für Algorithmen sei die smartphonebasierte Fundusfotografie. „Sie wurde in Südindien entwickelt, wo 10 % der Menschen Diabetes haben“, erzählte die Referentin. Inzwischen gebe es eine Reihe zertifizierter Adapter, die eine ausreichend hohe Bildqualität ermöglichen. „Wenn man genügend viele Bilder hat, kann man diese per Deep Learning auswerten. Der Algorithmus kann lernen und Zusammenhänge erkennen.“ Unter Studienbedingungen schlügen sich Systeme wie EyeArt, IDx-DR, SELENA+ hervorragend und könnten eine (visusbedrohende) diabetische Retinopathie mit hoher Sensitivität (87 % bis 96 %) und Spezifität (88 % bis 94 %) detektieren, erklärte Dr. Xia. Unter Real-World-Bedingungen kann die smartphonebasierte Fundusfotografie mit diesen Ergebnissen aber nicht mithalten: Hier hätten sich bei der Analyse von über 300.000 Bildern der Netzhaut sehr starke Schwankungen bei Sensitivität (51 % bis 86 %) und Spezifität (60 % bis 84 %) ergeben, betonte sie.1
Vorhandene Daten aus den Praxen besser nutzen
Auch Dr. Justus Wolf, Bioinformatiker an der Technischen Universität München, attestierte KI-Anwendungen im Gesundheitswesen eine gewaltige Lücke zwischen vielversprechenden Ergebnissen in akademischen Settings versus unzureichender Implementation in der realen Versorgung. Sein Zugang ist daher ein pragmatischer: „Wir müssen nun einmal mit den Daten arbeiten, die wir in der Realität haben, auch wenn sie manchmal lücken- oder fehlerhaft sind.“ Er sprach sich dafür aus, die in den Diabetespraxen ohnehin vorhandenen Daten besser zu nutzen, etwa um bei bestimmten Patient*innen potenzielle Risikofaktoren besser zu erkennen.
Ratschläge von Chatbots kritisch hinterfragen Während ChatGPT jeder Antwort vorausschickte, es sei kein Arzt und könne daher nur allgemeine Informationen geben – diese waren auch überwiegend fachlich korrekt – überraschte Google Bard mit zum Teil sehr abenteuerlichen Ratschlägen wie etwa, bei einem Blutzuckerspiegel über 250 mg/dl 10 bis 15 Gramm schnell wirkende Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. „Google Bard scheint ein Muster zu haben, dass man bei hohen Glukosewerten Kohlenhydrate essen sollte. Was soll jemand aus diesen Informationen schließen, der gerade erst die Diagnose Typ-1-Diabetes erhalten hat?“, kritisierte Dr. Ehrmann. „Mein Rat: Spielen Sie ruhig einmal damit herum, um sich für das Thema zu sensibilisieren.“ Er empfahl, Patient*innen in Schulungen aktiv darauf anzusprechen, dass dialogbasierten Chatbots nur bedingt als rund um die Uhr verfügbare Diabetesratgeber taugen. Doch auch Ärzt*innen sollten beim Umgang mit diesen Tools Vorsicht walten lassen. So könne man sich zwar durchaus lange wissenschaftliche Studien kurz und knapp in deutscher Sprache von einem Chatbot zusammenfassen lassen. „Das sieht auf den ersten Blick auch gut aus. Doch manchmal dichtet die KI auch Dinge hinzu, die gar nicht in der Studie stehen“, warnte Dr. Ehrmann. Da hilft dann am Ende doch nur eins: die Studie selbst im Original lesen. |
Dr. Wolf erklärte: „In jedem Praxisverwaltungssystem (PVS) sind unglaublich viele longitudinale Daten von Menschen gespeichert, aus denen sich verschiedene Wahrscheinlichkeiten ableiten lassen.“ Hierzu zählten z. B. Alter, Hypertonie und Adipositas mit den entsprechenden Diagnosen, Therapien und Ergebnissen. „Die Daten sind nicht immer vollständig, aber das ist nun einmal die Realität“, so der KI-Experte. Sogar ohne Anbindung an eine cloudbasierte Datenbank könne eine KI mithilfe von Mustererkennung auf spezifische Risiken hinweisen. „Das System meldet dann auf dem Dashboard der Patientenakte, dass es ein erhöhtes Risiko erkannt hat – und der Arzt entscheidet, ob er diesem Hinweis folgen möchte oder nicht.“
Passendes PVS-Dashboard muss eingefordert werden
Der einzige Haken an diesem Vorschlag kam in der anschließenden Diskussion zur Sprache. So meinte ein Teilnehmer, man könnte durch entsprechende Verknüpfung theoretisch bereits seit 20 Jahren prognostische Daten zur diversen Folgeerkrankungen aus den PVS generieren. Allerdings stellten die PVS-Anbieter bis dato kein entsprechendes Dashboard zur Verfügung, auf dessen Oberfläche man auf einen Blick sämtliche statistischen Risikofaktoren einzelner Patient*innen ablesen kann. „Sie werden das auch nicht von sich aus einrichten. Wir haben es in der Vergangenheit aber auch nicht eingefordert – und sollten es nun unbedingt tun!“
Literatur:
[1] Lee et al. Diabetes Care 2021; 44 (5): 1168–1175; doi: 10.2337/dc20-1877
Antje Thiel
Diatec 2024